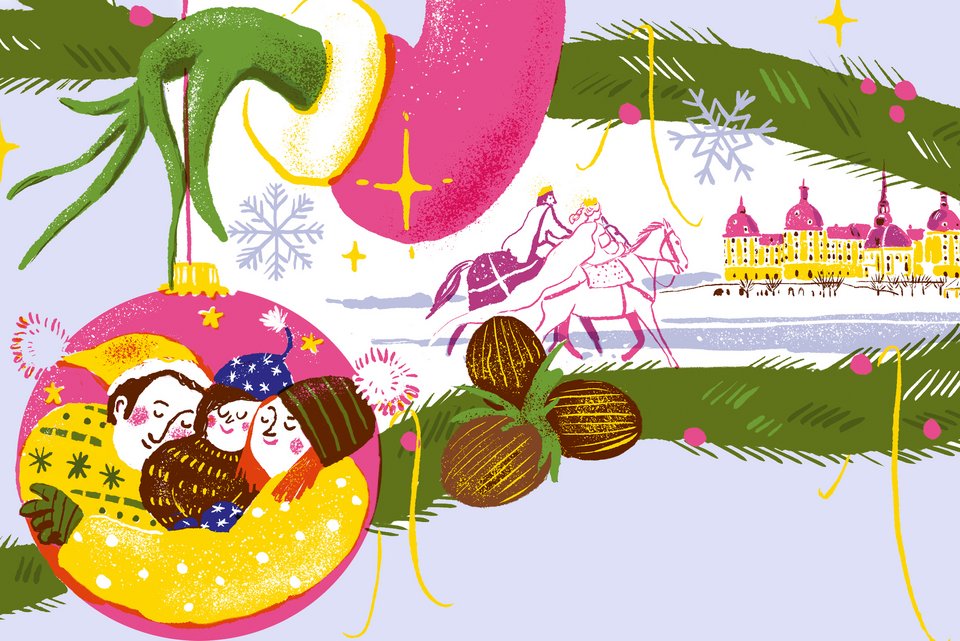Nur noch fünf Wochen bis Weihnachten, der Countdown fürs Fest der Liebe läuft, schließlich soll der benachbarte Stuhl an der Festtafel nicht vakant bleiben. In der britischen Komödie Tatsächlich… Liebe traut sich Laura Linney alias Sarah nach Jahren des Gehemmtseins, im Büro endlich ihr Objekt der Begierde anzusprechen, ihren Kollegen Karl. Doch immer wenn sich die beiden im Laufe des Films näherkommen, wird das Handy klingeln. Es ist Sarahs Bruder, der in der Psychiatrie sitzt und mit ihr sprechen will.…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
wird das Handy klingeln. Es ist Sarahs Bruder, der in der Psychiatrie sitzt und mit ihr sprechen will. Die Angerufene wird immer abnehmen – entnervt zwar –, lieber für den Bruder da sein, als die mögliche Liebe zum Leben zu erwecken.
Tatsächlich… Liebe, erschienen 2003, gehört längst zum Repertoire der wichtigsten Weihnachtsfilme und hält sich dort unter Klassikern wie Ist das Leben nicht schön (1946), Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973), Kevin, allein zu Haus (1980) oder Stirb langsam (1988) unter den gefühlten Top Ten. Auf den ersten Blick hat die sympathische Schmonzette allerdings wenig mit fröhlicher Weihnacht zu tun. Es wird betrogen, aneinander vorbei geliebt, gepöbelt und getratscht. Und auf Instagram fragen sich Userinnen, die sich alle Jahre wieder dem Sog des Films nicht entziehen können: Was hat das alles mit Weihnachten zu tun? Wo sind die Schneeflocken und das heimelige Kaminfeuer?
Doch ganz so einfach verhält es sich nicht mit den Filmen zum Fest. Andrea Geier, Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Geschlechterforschung an der Universität Trier, schreibt im Vorwort des Buches Weihnachtsfilme lesen, diese sähen sich „in besonderer Weise einem Trivialitäts- und Kitschverdacht ausgesetzt. Zu Unrecht.“ Geier attestiert dem Genre durchaus politische Kraft, ist es doch in großem Stil während des Zweiten Weltkriegs entstanden, als „in mehreren westlichen Ländern, vor allem bei den Kriegsparteien, der Bedarf an sozialem Zusammenhalt in der Bevölkerung“ stieg.
Eine kuschelige Behaglichkeit
Zu den Vorreitern gehören die USA: Im Jahr 1942 kam der Film Holiday Inn in die Kinos (deutsche Fassung: Musik, Musik), ein Tanzfilm mit Fred Astaire und Bing Crosby, der mit Schneeflocken und dem Weihnachtssong White Christmas eine damals ganz neue, kuschelige Behaglichkeit inszenierte. Das Credo: Lasst uns singen, zusammenrücken, die Welt zu einer friedlichen machen. Damals übernahm der Weihnachtsfilm die wichtige soziale Aufgabe, „eine in Krisenzeiten besonders gefragte gesellschaftliche Stützstruktur zu installieren“, so Geier.
Es entstand ein Genre, das wie kein anderes an Normen der westlichen Gesellschaft arbeitete. Diese Normen würden aber nicht nur konsolidiert, „sondern auch auf ihre dunklen Kehrseiten hin ausgeleuchtet“.Schließlich geht es in erfolgreichen Popcorn-unterm-Tannenbaum-Movies nicht nur behaglich zu. Es gibt knallharte Action wie eben Stirb langsam oder das Genre der Weihnachtshorrorfilme. Intention hier: die Verlogenheit, die Unmöglichkeit von familiärem Zusammenhalt aufs Korn zu nehmen.
Von der Kulturindustrie belogen
Die US-Psychologin Pamela Rutledge stellte kürzlich für Psychology Today fest, dass wir beim Schauen von (vornehmlich süßlichen) Weihnachtsklassikern „unsere Sehnsucht nach Geliebtwerden stillen“ möchten. Natürlich spiele auch der Faktor Nostalgie eine wichtige Rolle: „Wir tendieren ja zu der kognitiven Verzerrung, dass früher alles besser war. Die typischen Plots mit idyllischer Kulisse und Happy End bestätigen uns da sehr.“ Das müsse nicht nur schlecht sein, denn die Filme reduzieren der Psychologin zufolge in einer extrem angespannten Zeit des Jahres das Kortisonlevel und damit Stress.
Rutledge weist darauf hin, dass es beim Christmas-Watching nicht nur um schnelles, hedonistisch erlebtes Glück gehe, sondern dass speziell die Dramen „langfristig sinnstiftend und inspirierend“ nachwirken könnten, weil sie mit ihrer Erzählung von Bescheidenheit, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft etwas anstießen.
Die Lesart, dass wir uns die Geschichten von Kevin, Bridget Jones oder dem Grinch ähnlich unkritisch wie zu viel Punsch und Stollen zuführen, greift deshalb auch für Annette Keck, Professorin für Kulturtheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, viel zu kurz. „Ich bin keine Freundin des Vorurteils, wonach die Zuschauenden doof sind und sich durch die Bank mit diesen Geschichten von der Kulturindustrie belügen lassen.“
Auch wenn Weihnachtsfilme „rudimentäre Phantasmen des Christentums aufrufen oder immer noch an einer patriarchal-bürgerlichen Ordnung festhalten“, gebe es doch Momente, die sich dem widersetzten. Diese sind extrem spannend für die Kulturwissenschaftlerin, da sie bei den Zuschauenden die Frage aufwerfen: „Muss ich mich dem fügen oder ist das nicht alles ein großer Bullshit?“
Jingle Bells, Single Bells
Keck führt die norwegische Dramedy-Serie Weihnachten zu Hause aus dem Jahr 2019 ins Feld. Protagonistin ist eine 30-jährige Krankenschwester, die am ersten Adventssonntag ihre Familie anlügt und behauptet, in einer Beziehung zu sein. Sie verspricht, ihren Freund zum Weihnachtsessen mitzubringen. In den verbleibenden Wochen setzt sie panisch auf Speeddating – Jung, Alt, Mann, Frau –, um am Ende festzustellen: Bis Weihnachten klappt das nicht. „Da versteht sie, dass es allein dieses Fest mit seinen Forderungen und Normen ist, das ihr solchen Stress macht“, so die Kulturwissenschaftlerin. Den Rest des Jahres genieße sie fröhlich ihr Singleleben.
„Nur jetzt rutscht sie in eine Krise, weil sie keine Partnerschaft vorweisen kann. Bis sie voller Trotz begreift: Allein Weihnachten macht, dass ich mich so defizitär fühle!“ Dass die Serie die normativen Vorgaben so über den Haufen werfe, hat laut Annette Keck etwas unheimlich Befreiendes und Emanzipatorisches.
Sie ist der Überzeugung, dass es in den Weihnachtsfilmen immer wieder Szenen gibt, die nicht mit der tradierten christlich-konservativen Erzählung vereinbar sind. Gerade die Vaterfiguren würden häufig als charakterlich schwach gezeichnet. Die Väter etwa in Tatsächlich… Liebe oder Bridget Jones sind keine starken. Keck sieht darin auch einen Hinweis auf die biblische Weihnachtserzählung mit ihren zwei Vätern. Dem irdischen, eher unbedeutenden und Gott. Die Forscherin betont, dass Weihnachten per se Krisen produziere. Weil eben immer noch das Diktat von der heilen beziehungsweise heiligen Familie propagiert werde und alle die, die dieses Modell nicht vorweisen könnten, zwangsläufig unter Druck gerieten.
Gerufene Geister
In dem Konflikt zwischen nichtexistenter heiler Welt und der „idiotischen Forderung“ nach ihr sieht die Wissenschaftlerin für Weihnachtsfilme enormes Potenzial. Sie zeigten nämlich auf, dass das Schöne, das in Familien entstehen kann, immer nur für einen Moment bestehe.
Gute, bewegende Geschichten helfen uns laut Keck auch bei der Emotionsregulierung, weil sie das Bedürfnis nach Geborgenheit und Verbundensein nicht nur thematisierten, sondern bis zu einem gewissen Grad auch befriedigten. Das psychisch belastete Fest mit seinen unerreichbaren Erwartungen an die Familienmitglieder führe regelmäßig zu Enttäuschungen.
„Wenn Filme dann diese Wunde heilen und nicht in unendlicher Nostalgie versinken, nehmen sie die Krisen, die Weihnachten auslöst, einerseits ernst, andererseits stellen sie sie als überwindbar dar.“ Kein guter Weihnachtsfilm also, der nicht krisenhaft beginnt, so Kecks Analyse. Ob das Kevin ist, der kurz vor Heiligabend von seinen Eltern zu Hause vergessen wird, oder Bill Murray als fieser Geizkragen in Die Geister, die ich rief… (nach Charles Dickens’ A Christmas Carol), der im Laufe des Films von Geistern zur Läuterung aufgefordert wird.
Gefühle unter den Teppich kehren
Wenn die Filme dann trotz aller Konflikte und Hürden am Ende gut ausgehen, erzählen sie uns manchmal eine bessere Geschichte als unsere eigene: Wir stecken als Familie meist in dem Dilemma, dass wir zwar zusammen feiern wollen (bisweilen müssen wir es) und dabei von der Sehnsucht getrieben sind, eine gute Einheit zu bilden, aber sich in der Regel die Motive, Erinnerungen und Perspektiven der einzelnen Familienmitglieder nicht decken.
Wer kennt das nicht: die ewig gleichen Auseinandersetzungen oder die schwierigen Themen, die unter den Teppich gekehrt werden? Weil – es ist ja Weihnachten! Hier können Weihnachtsfilme nach Kecks Auffassung wie ein Katalysator wirken, sogar eine beruhigende, aufklärerische Instanz sein, ja Bindung schaffen. Die Literaturwissenschaftlerin findet: „Sie reinszenieren dieses Ritual der unterschiedlichen Narrative, kommen aber am Ende zu einer Lösung.“ Sie zeigen, was familiäre Kohärenz darstellt, aber auch, wie viel Mühe es kosten kann, sich als Familie zu finden. Keck ist sich sicher: „Das Schauen dieser Filme kann therapeutisch wirken.“
"Da läuft ganz viel in das Unbewusste."
Auch Psychotherapeut Dr. Otto Teischel ist davon überzeugt, dass gute Filme „uns zum Wesentlichen bringen; uns an Werte erinnern, die wir nicht mehr leben, an Bedürfnisse, die unerfüllt bleiben“. Und an Weihnachtsfilmen lasse sich das besonders gut erhellen. Der Philosoph und Analytiker praktiziert in Klagenfurt seit vielen Jahren erfolgreich Filmtherapie – seit einiger Zeit sogar in einem eigenen kleinen Kinosaal im Untergeschoss des Wulfenia-Kinos.
Das Prinzip: Die gezeigten Filme fungieren als Fallgeschichten, die beim Publikum Emotionen auslösen und anschließend in der Gruppendiskussion reflektiert werden: Inwiefern erinnert die Geschichte an die eigene? Wie schaffen es die Protagonistinnen und Protagonisten, ihre Probleme zu überwinden? Warum löst eine Szene Wut, Trauer oder Freude aus?
Teischel erklärt, „dass unser Kopf nicht dagegen ankommt, da läuft ganz viel über das Unbewusste“. Und sofort tauchten die entscheidenden Fragen auf: Habe ich Angst vor Gefühlen? Oder: Warum bin ich jetzt zu Tränen gerührt? Der Psychotherapeut weiß, dass man es an Weihnachten vielleicht gerade noch schafft, ein festes Ritual als Familie hinzukriegen. Doch ehe man sich versieht, kracht es schon, die Stimmung kippt. „Das ist unglaublich aufgeladen.“ Statt sich wie gewöhnlich in die Haare zu kriegen oder in das übliche Schweigen zu verfallen, „sollten wir an den Feiertagen viel mehr den Mut haben, über unsere Gefühle zu sprechen. Thematisieren, warum wir als Familie nicht kommunizieren.“ Und hier vermag ein Film, den man zusammen schaut, unheimlich viel auszulösen, weil er uns ins Gespräch bringen kann.
Allerdings, so der Experte, müsse man unterscheiden, ob man sich einen Film einfach nur „reinzieht wie eine Süßigkeit und sich mit einem Plot, der einfach nur Harmonie feiert, betäubt“. Oder ob man sich auf eine Geschichte einlasse, die Konflikte, verborgene Sehnsüchte zeigt. „Der Mensch bewegt sich immer zwischen den beiden Polen Sucht und Sehnsucht.“ Man könne Filme so schauen, dass sie wie eine Droge wirkten und nur im Moment entlasteten. Das sei typische Unterhaltung, Berieselung. Das Gegenteil sei für den Kino-Enthusiasten indes eine Geschichte, die einem Freiheit eröffne, die dazu auffordere, den eigenen Sehnsüchten nachzuspüren, selbst wenn es wehtue.
Betäubende Harmonie
In diesem Sinne kann sich Teischel gut vorstellen, im Kreis der Familie „sich auf das Wagnis Weihnachtsfilm einzulassen. Ja, warum es nicht zu einem Hauptritual werden zu lassen?“ Allerdings als Alternative zur Show, als die wir Weihnachten heute vor allem inszenieren: „Das hat ja ganz viel Eventcharakter, wir schütten uns mit Geschenken zu, spielen uns etwas vor.“ Würden wir uns aber von einer fremden wahrhaftigen Geschichte mit ungewohnten Wendungen berühren lassen – „und das muss ja nicht immer der ewige Dickens sein“ –, könnten wir uns der ursprünglichen Idee von Weihnachten wieder annähern, „die ja ganz viel mit Liebe, tatsächlicher Begegnung, aber auch Demut zu tun hat“.
Der Therapeut führt als „hervorragendes“ Beispiel einen Film an, den die Regisseurin Vivian Naefe 2012 fürs ZDF gedreht hat: Obendrüber, da schneit es. Er zeigt, wie die verschiedenen Parteien in einem Mietshaus versuchen, mit dem Mut der Verzweiflung in festliche Stimmung zu kommen.
Da ist die frisch getrennte Mutter, ein junges Paar, das sich zofft, zwei Witwer, ein trauriger Teenager, ein älteres Paar: Sie tritt frustriert in einen Weihnachtsstreik, weil er vergaß, die Gans für den Festtagsbraten rechtzeitig abzuholen. Erst als ein Pfarrer, der noch am Abend eine Predigt halten soll, vor dem Haus im Schnee ausrutscht und von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses vorübergehend versorgt wird, gerät die mühsam aufrechterhaltene Contenance aller ins Wanken. Es bricht etwas auf, Schwächen und alte Wunden werden nicht mehr versteckt. Man reicht sich gegenseitig die Hand, lässt Fragen zu.
„Diese Filme kommen nicht ohne das wichtige Moment des Unbegreiflichen aus, eine große Rührung, der wir uns nicht verschließen können“, so Teischel. Darin kehre der Zauber zurück, den wir oft als Kind verspürten, als wir noch ans Christkind geglaubt haben.
Quellen
Andrea Geier, Irina Gradinari, Irmtraud Hnilica (Hg.): Weihnachtsfilme lesen. Familienordnungen, Geschlechternormen und Liebeskonzepte im Genre. Transcript 2022
Andrea Geier, Irina Gradinari, Irmtraud Hnilica (Hg.): Weihnachtsfilme lesen II. Von Krisengeschichten und Wunschszenarien. Transcript 2023
Karl-Heinz Göttert: Weihnachten. Biographie eines Festes. Reclam 2021
Otto Teischel: Die Filmdeutung als Weg zum Selbst. Einführung in die Filmtherapie. Books on Demand 2007