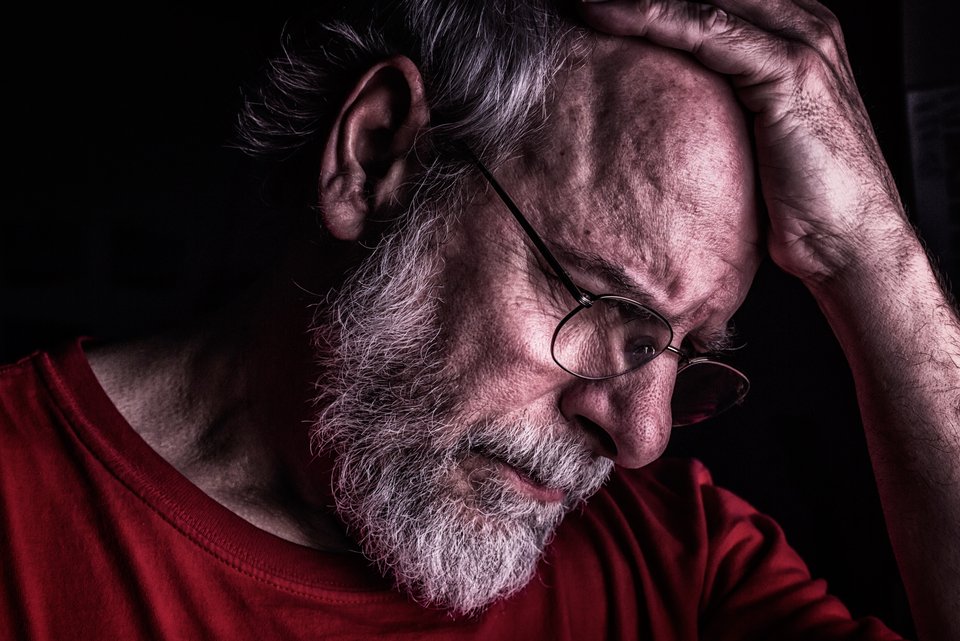Nicht wegen seines akuten Leidens, sondern aus Angst vor der drohenden „ausweglosen Krankheit A.“, die er nicht einmal mit ihrem Namen nennen mochte, nahm sich am 7. Mai 2011 der 78-jährige Gunter Sachs das Leben. Sein Abschiedsbrief wurde von den Angehörigen auf Sachs’ eigenen Wunsch hin veröffentlicht, möglicherweise um damit die tabubesetzte Krankheit stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
In der Tat hat der Suizid des ehemaligen Playboys, Geschäftsmanns, Fotografen und Kunstsammlers eine…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
zu rücken.
In der Tat hat der Suizid des ehemaligen Playboys, Geschäftsmanns, Fotografen und Kunstsammlers eine Zeitlang die mediale Öffentlichkeit beschäftigt, wie zuletzt auch die Alzheimererkrankung des ehemaligen Fußballmanagers Rudi Assauer.
Der Betroffene bleibt weiterhin ein Jemand
Natürlich steht es niemandem zu, über den Freitod eines anderen Menschen zu rechten. Darüber aber, ob und inwiefern ein Weiterleben mit dieser Krankheit wirklich nicht mehr lebenswert ist, darf und sollte man sich ein Urteil bilden. Denn Alzheimer ist keine ausweglose Krankheit.
Vielmehr kann man mit ihr aufgehoben weiterleben, und zwar verstanden in einem dreifachen Sinne des Wortes: Auch wenn unsere geistigen und emotionalen Fähigkeiten weitgehend abgestorben sind, so bleibt von uns erstens nicht nur ein bloßes Etwas oder eine Sache übrig, sondern wir bleiben zweitens als ein Jemand oder eine Person erhalten. Drittens können wir in der Obhut anderer geborgen weiterleben.
Bei aller Tragik dieser Krankheit sollte ein von ihr Betroffener nicht wie ein toter Gegenstand in einer Abstellkammer namens Pflegeheim aufbewahrt werden oder vielleicht besser gleich sterben, sondern er kann als Mensch weiterleben, vorausgesetzt, die Gesellschaft und andere Personen nehmen sich seiner an.
Angst vor dem schleichenden Beginn
Was beinhaltet die Angst, infolge von Alzheimer als Mensch abzusterben? In seinem Abschiedsbrief schreibt Gunter Sachs: „In den letzten Monaten habe ich durch die Lektüre einschlägiger Publikationen erkannt, an der ausweglosen Krankheit A. zu erkranken.“ Vermutlich hatte er gelesen, dass die Krankheit mit leichteren Gedächtnis-, Wortfindungs- und Orientierungsstörungen beginnt und in ihrer letzten Phase mit einem nahezu völligen Verlust der kognitiven und emotionalen Fähigkeiten endet.
Die Angst vor Alzheimer richtet sich nicht nur auf ihren – nach dem Stand der heutigen Medizin – unheilbaren Verlauf, sondern auch auf ihren kaum merklichen Beginn, wie Gunter Sachs für sich selbst befürchtete: „Ich stelle dies heute noch in keiner Weise durch ein Fehlen oder einen Rückgang meines logischen Denkens fest – jedoch an einer wachsenden Vergesslichkeit wie auch an der rapiden Verschlechterung meines Gedächtnisses und des meiner Bildung entsprechenden Sprachschatzes. Dies führt schon jetzt zu gelegentlichen Verzögerungen in Konversationen.“
Statt sich mit seiner Angst einem Arzt anzuvertrauen, verließ sich Gunter Sachs allein auf seine Selbstdiagnose; möglicherweise litt er gar nicht an Alzheimer, sondern an einer Altersdepression.
Menschsein nicht an Leistungsfähigkeit definieren
Alzheimer bedeutet keineswegs, nicht mehr als Mensch weiterleben zu können, wie Gunter Sachs in seinem Abschiedsbrief schrieb und dabei in erster Linie den Verlust seiner geistigen Fähigkeiten befürchtete: „Jene Bedrohung galt mir schon immer als einziges Kriterium, meinem Leben ein Ende zu setzen. Ich habe mich großen Herausforderungen stets gestellt. Der Verlust der geistigen Kontrolle über mein Leben wäre ein würdeloser Zustand, dem ich mich beschlossen habe, entschieden entgegenzutreten.“
Wenn man, wie Gunter Sachs, „geistige Kontrolle“ mit „logischem Denken“ gleichsetzt, geht man von einem verengten Bild von „Geist“ oder „Vernunft“ aus. Und man hat eine Vorstellung vom Menschen und einem guten Leben, die unserer funktionalen Leistungs- und Wissensgesellschaft entspricht und ihre Wurzeln in der Tradition einer verengten rationalistischen Philosophie hat, etwa von Descartes. Danach versteht sich der Mensch primär als vernunftbegabt.
Die klassische aristotelische Definition des Menschen als animal rationale muss aber in ihren beiden Komponenten zusammen beachtet werden: Wir sind als Menschen vernunftbegabt und zugleich sinnliche, emotionale Lebewesen. Dies hat auch der zu Unrecht als leibfeindlich geltende Philosoph Platon gewusst, wenn er etwa in seinem Dialog Philebos für eine „gemischte Lebensweise“ aus Vernunft und Lust oder Sinnlichkeit plädiert.
Auch in späten Krankheitsphasen gibt es noch Genussmomente
In der neueren Verhaltensforschung und Neurobiologie, aber auch in der Philosophie beginnt sich schon längst die Einsicht durchzusetzen, dass auch Tiere graduell denken können und umgekehrt die denkenden Menschen ein tierisches Erbe haben. Vernunft und Sinnlichkeit gehören zusammen. Daher ist eine geistige Kontrolle des eigenen Lebens auch dann möglich, wenn man seine sinnlichen Bedürfnisse und Wünsche nur noch durch minimale Äußerungen mitteilen kann.
Hierfür haben die Forschungen zur Lebensqualität des Heidelberger Teams um den Gerontologen Andreas Kruse empirische Belege gebracht. Mimische oder gestische Äußerungen eines dementen Patienten können und müssen als dessen Willensäußerungen verstanden werden, zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme, der Mobilität und der Körperhygiene.
Daher ist auch der Kritik des Alzheimerforschers Hans Förstl zuzustimmen, der in einem Interview einer verbreiteten Bewunderung von Gunter Sachs’ Freitod als einer vermeintlich konsequenten Handlung mit deutlichen Worten widerspricht:
„Das ist arrogantes Geplapper. Leute, die jetzt applaudieren, kennen die Realität nicht. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren. (…) Ich bin oft erstaunt, wie zufrieden viele Menschen mit Alzheimerdemenz wirken. (…) Selbst in späten Krankheitsphasen gibt es noch immer Genüsse, oft kindliche, die von Bedeutung sind.“
Sinnliche Zufriedenheit bleibt
So berichtet etwa Tilman Jens in seinem Buch über die Demenz seines Vaters, wie der ehemals hochangesehene Rhetorikprofessor und Schriftsteller Walter Jens zusammen mit seiner Pflegerin Margit den Besuch auf deren Bauernhof genießt und mit einem Kinderbuch äußerst mühsam versucht, neu lesen zu lernen: „Ich möchte weinen. Er aber fühlt sich wohl. Was an Margit, aber auch an dem vielen Spielzeug, den Malbüchern, der bunten Kinderknete liegt, die sie ihm vom Dachboden geholt hat. (…) Als er zurück ist in Tübingen, wird er meiner Mutter erzählen: Caro (der Hofhund) ist der beste …“
Ähnlich beschreibt auch der Schriftsteller Arno Geiger in seinem Bestseller Der alte König in seinem Exil in einem anrührenden, oft heiteren Ton, wie sein Vater trotz seiner schweren Demenz sinnlich zufrieden weiterlebt und eine eigene Sprache entwickelt.
Auch wenn man also trotz des weitgehenden Verlusts seiner normalen geistigen Fähigkeiten als Mensch sinnlich zufrieden weiterleben kann, ist nicht zu leugnen, dass die Alzheimerkrankheit in ihrem letzten Stadium mehr und mehr zu einem Verlust der eigenen Kräfte führt, bis man zu einem bloßen Pflegefall wird, ohne über sein Leben selbst bestimmen zu können.
Selbstbestimmung und Wohlbestimmung
Wie kann man dennoch als Mensch in der Obhut anderer weitgehend ohne Selbstbestimmung weiterleben? Zum Verhältnis von „Demenz und Selbstbestimmung“ hat der Deutsche Ethikrat im Jahr 2012 eine ausführliche Stellungnahme mit konkreten pflegerischen und juristischen Empfehlungen veröffentlicht.
In bestimmten Situationen kann, wie der Ethikrat betont, „die nicht mehr mögliche Selbstbestimmung des Betroffenen durch die Wohlbestimmung seitens der Pflegenden und Betreuenden ersetzt“ werden. Hierbei werden in der Stellungnahme Situationen von „abstrakten, erlebnisfernen Entscheidungen“ (Wahlen, Finanzangelegenheiten und so weiter) genannt oder wenn bei Patientenwünschen klare Zumutbarkeitsgrenzen der Pflegenden überschritten werden, auch wenn eine Schadensabwendung zugunsten des Patienten erforderlich ist.
Der Grenzfall einer Wohlbestimmung ohne Selbstbestimmung im späten Stadium der Alzheimerdemenz wird dabei nicht erwähnt, der ähnlich auch bei Komakranken vorliegt. Offensichtlich herrschte in dem Ethikrat, dem auch mehrere Theologen und Kirchenvertreter angehörten, ein grundlegender Dissenz darüber, wie ein Weiterleben in einer derartigen Situation zu bewerten sei.
Darf Suizid als Lösung gesehen werden?
Der Berliner Philosoph Volker Gerhardt etwa, Mitglied des Ethikrats, bewertet den Grenzfall einer Wohlbestimmung ohne Selbstbestimmung in seinem Sondervotum als „biografische Katastrophe“. „Wer“, so kritisiert er scharf, „nicht in aller Deutlichkeit sagt, dass hier unwiderruflich etwas zu Ende geht, was eine Person im Umgang mit ihresgleichen ausmacht, der verharmlost die Demenz.“ In seinem Sondervotum fordert er daher, dass trotz aller notwendigen Fürsorge ein „vor der Demenz“ geäußerter Wunsch respektiert werden müsse, „selbstbestimmt zu sterben, ehe man zu einem unmündigen Pflegefall wird“.
Die Forderung des Philosophen Volker Gerhardt wurde umgehend vom Augsburger Weihbischof Anton Losinger öffentlich kritisiert, der selbst ein Mitglied des Ethikrats war: „Ich kritisiere die Position, die lautet: in der Phase der Entstehung von Demenz die Freiheit zum Suizid als eine Lösung zu sehen.“
Die Alzheimerkrankheit konfrontiert uns mit der Tatsache, dass wir grundsätzlich und nicht nur ausnahmsweise auf die Fürsorge anderer angewiesen sind, von Geburt an über schwere Krankheiten bis ins hohe Alter hinein, selbst in normalen alltäglichen Interaktionen. Mündigkeit kann daher nie uneingeschränkte Selbstsorge bedeuten.
Grenzen der Mündigkeit sind eine Frage der Ansicht
Was es heißt, als „unmündiger Pflegefall“ weiterzuleben, hängt daher davon ab, wie man Mündigkeit und Autonomie versteht. Wenn man wie Gunter Sachs nach einer weitverbreiteten Auffassung darunter eine uneingeschränkte „geistige Kontrolle“ über sein eigenes Leben versteht oder wie Volker Gerhardt – in der Sache ähnlich, aber in einer reflektierten philosophischen Sprache – „die auf Selbstbeobachtung, Selbstreflexion und Selbstverantwortung beruhende Selbstbestimmung des eigenen Lebens“, bedeutet das Weiterleben mit Alzheimer im letzten Stadium tatsächlich, als unmündiger Pflegefall dahinzuvegetieren, wobei allerdings fließende Übergänge vorliegen.
Nach dieser Auffassung hätte der „vor der Demenz“ geäußerte Wunsch eines Patienten Vorrang vor seiner aktuellen bloßen Zufriedenheit als unmündiger Pflegefall, vor dem er sich rechtzeitig gerade schützen wollte. Wenn man dagegen einem Menschen Mündigkeit auch dann zuspricht, wenn er nur noch minimale sinnliche Bedürfnisse selbständig und auch nonverbal äußern kann, hat sein aktueller Lebenswunsch Vorrang vor einer früher geäußerten Auffassung.
Walter Jens beispielsweise hat sich vor seiner Demenzerkrankung zusammen mit dem katholischen Theologen Hans Küng öffentlich für die aktive Sterbehilfe eingesetzt. Während seiner schweren Demenzkrankheit dagegen hat er offensichtlich durchaus in einem eingeschränkten Sinn von Mündigkeit weiterleben wollen, wie sein Sohn schreibt:
„Ohne Frage. So wie er nun lebt, gefüttert, gewindelt, umgeben von vergessenen Büchern, hat er niemals leben wollen. (…) Sieht so ein Leben aus, das – wie er einst dachte – im Sinne des Humanen keines mehr ist? (…) Der Vater, den ich kannte, der ist lang schon gegangen. (…) Aber jetzt, da er fort ist, habe ich einen ganz anderen Vater entdeckt, einen kreatürlichen Vater.“ Auch Inge Jens ist trotz aller Unsicherheit davon überzeugt, dass ihr Mann „nicht um Hilfe zum Sterben, sondern um Hilfe zum Leben bittet“.
Nicht jedem fällt es leicht, sich anderen anzuvertrauen
Niemand wünscht sich natürlich vorher, als „unmündiger Pflegefall“ weiterleben zu müssen, und niemand sollte ein solches Leben schönreden. Die „Krankheit A.“ muss aber keineswegs als „ausweglos“ erlebt werden und auf eine „biografische Katastrophe“ zulaufen. Selbst wenn die Person, die man oder die sich selbst kannte, „lange schon gegangen“ ist, bleibt sie als „kreatürliche“ Person weiterhin erhalten und kann in der Fürsorge anderer geborgen weiterleben.
Wie aber kann man geborgen weiterleben? Natürlich hängt dies zunächst von den finanziellen Rahmenbedingungen und der familiären oder professionellen Pflegesituation ab, auch davon, was einer Gesellschaft das Leben „unnützer“ Menschen wie Demenzkranker wert ist. Wichtig aber ist auch die allgemeine Welthaltung des Einzelnen.
Der Kranke bedarf nicht nur der Fürsorge anderer, sondern er muss sich anderen auch anvertrauen. Hierzu ist nicht jeder fähig. Die allgemeine Haltung, die jemand zur Welt oder zu anderen Menschen einnimmt, kann höchst verschieden sein.
Sie kann, wie der Sozialtheoretiker Hartmut Rosa unterscheidet, durchaus in einem wünschenswerten Existenzgefühl der Geborgenheit bestehen, aber oft auch im Gefühl einer bloß bürgerlichen Sicherheit, eines labilen Gleichgewichts oder einer kalten, verzweifelten Geworfenheit. Als Ursache dieser unterschiedlichen Welthaltungen vermutet Hartmut Rosa eine Mischung von genetischer Veranlagung, frühkindlicher Prägung und zeithistorischer Strömung.
Reziprozität der Geborgenheit
Nur in einem Existenzgefühl der Geborgenheit aber kann man sich einem anderen anvertrauen, etwa als hilfsbedürftiger Pflegefall. Um ein derartiges grundlegendes Existenzgefühl kann man sich trotz der genannten Ursachen oder Determinanten auch selbst kümmern und dabei psychologische, theologische oder, in der Tradition der Antike, auch philosophische Beratung als Lebenskunst (Ars Vivendi) zur Hilfe nehmen, und dies in einer individualisierten Mischung und möglichst früh.
Jeder hat ein Recht auf eine basale Versorgung. Und niemand ist über seine eigenen Kräfte hinaus zur Fürsorge anderer verpflichtet. Aber niemand kann eine liebevolle Geborgenheit durch andere erwarten, der sich nicht Zeit seines Lebens auch selbst um andere gekümmert hat. Der oft beklagte Egoismus der Jugend hält sich mit dem Egoismus des Alters durchaus die Waage. Jeder klagt Rechte vom anderen ein, die er selbst nicht beachtet.
Vielleicht aber gibt es jenseits der intergenerationellen wechselseitigen Fürsorge dennoch eine bedingungslose Geborgenheit und Liebe. Religiös kann man sich bedingungslos aufgehoben fühlen „in der Hand Gottes“. Statt einer Bibel fand ich kürzlich auf dem Nachttisch meines Hotels einen Band mit einem Gedicht von Christian Morgenstern (1871–1914):
Ich hebe gerne Blumen auf vom Boden,
die andre achtlos fortgeworfen haben,
und gebe ihnen, was man Blumen gibt.
So sterben sie, statt kalt im Kot begraben,
doch noch den süßesten von allen Toden:
den Tod bei einem Wesen, das sie liebt.
Prof. em. Dr. Ekkehard Martens lehrte Didaktik der Philosophie und Alten Sprachen an der Universität Hamburg. Veröffentlichung: Lob des Alters. Artemis & Winkler, Mannheim 2011
Quellen
Deutscher Ethikrat: Demenz und Selbstbestimmung. Stellungnahme. Berlin 2012. (Internetfassung)
Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil. Dtv, München 2012
Inge Jens: Ein Nach-Wort in eigener Sache. In: Walter Jens, Hans Küng: Menschenwürdig sterben. Piper, München 2010 (2. Auflage)
Tilman Jens: Demenz. Abschied von meinem Vater. Goldmann, München 2010
Hartmut Rosa: Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Suhrkamp, Berlin 2012