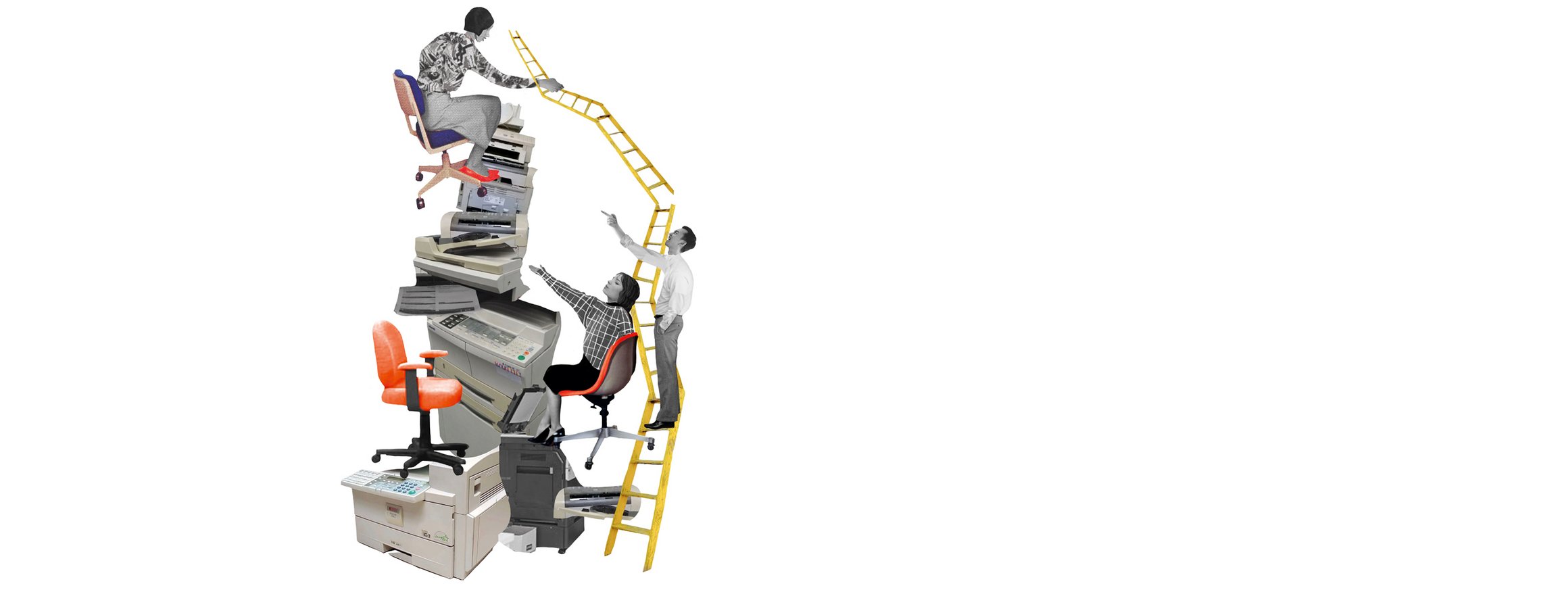Privat bin ich nachsichtig. Bis ich mich beschwere, dauert es. Aber beruflich muss ich meckern. Ständig. Da rechnet ein Mitarbeiter seine Dienstreisen falsch ab, ein anderer schafft seine Arbeit nicht und eine dritte meldet sich regelmäßig krank. All das landet dann auf meinem Schreibtisch.
Ich arbeite in der Finanzverwaltung. Als Führungskraft trage ich Verantwortung dafür, dass die Arbeit meiner Abteilung fehlerfrei und pünktlich erledigt wird. In meiner Rolle als Vorgesetzte muss ich Mitarbeitenden Dinge sagen, die ihnen nicht gefallen. Ansagen machen kann ich. Aber ich leide darunter, deshalb immer als Buhmann zu gelten.
Sie sagen, ich sei herrisch
Bevor ich ein schwieriges Mitarbeitergespräch führe, überlege ich: Welche Möglichkeiten habe ich? Was kann ich tun? Gibt es Alternativen? Aber wenn ich zum Beispiel den Beförderungswunsch einer Mitarbeiterin nicht unterstützen kann, gibt es keinen Kompromiss. Sie hält sich für toll, ich nicht. Das muss ich ihr sagen. Selbst wenn ich es wertschätzend formuliere und es ihr schonend beibringe, findet sie mich danach blöd. Das wiederum tut mir weh.
Ich versuche, viel Wertschätzung zu geben, und ich bekomme wenig zurück. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind häufig nicht in der Lage, das Sachliche von dem Persönlichen zu trennen. Sie hören Kritik, fühlen sich beleidigt und beleidigen zurück. Dann sagen sie mir zum Beispiel, ich sei herrisch, habe einen Diktierton oder: „Das war ja wieder klar, dass du so handelst.“ Mir wurde schon vorgeworfen, ich sei nicht objektiv oder keine gute Vorgesetzte.
Das trifft mich, denn ich tue, was ich kann. Eine gute Kommunikation ist mir wichtig. Für ein einstündiges Gespräch bereite ich mich oft drei Stunden vor. Ich erstelle einen Gesprächsleitfaden, überlege mir konkrete Beispiele, schreibe sie auf, formuliere meine Kritik in Ich-Botschaften wie „Mir ist aufgefallen“ oder „Ich habe wahrgenommen“ und gebe der Person Raum für ihre Sichtweise. Den Ablauf des Gesprächs spiele ich gedanklich so lange durch, bis ich alles auf den Punkt bringen kann.
Die Vorgesetzte, die sich nicht unter Kontrolle hat
Außerdem versuche ich immer, wertschätzend zu kommunizieren. Selbst wenn jemand völlig blöd gehandelt hat, soll man mir das nicht anmerken. Meine Regel lautet: Nicht emotional werden. Wenn mich etwas geärgert hat, spreche ich es aus Prinzip erst an dem nächsten Tag an. Diese 24 Stunden helfen mir, es zu verarbeiten. Auf keinen Fall möchte ich eine Vorgesetzte sein, die sich nicht mehr unter Kontrolle hat und in Rage redet. Das habe ich selbst einmal bei einem Chef erlebt und weiß, wie unpassend es ist.
Da ich im öffentlichen Dienst arbeite, bin ich darauf angewiesen, die Leute zu überzeugen. Ich habe weniger Instrumente zur Hand als eine Führungskraft in der freien Wirtschaft. Weder kann ich verwarnen noch entlassen und ebenso wenig Boni verteilen. Im Gegenteil. Übe ich zu viel Druck aus, kann es sein, dass sich jemand drei Monate lang krankmeldet. Daher wäge ich immer ab, wann ein Gespräch sinnvoll ist. Manchmal denke ich: Jetzt müsstest du auf die Pauke hauen. Und entscheide mich trotzdem dagegen.
In vielen Fällen muss ich handeln. Ein Mitarbeiter schafft in seiner Arbeitszeit zum Beispiel viel weniger als alle seine Kolleginnen und Kollegen. Im Führungsjargon sagt man über so jemand „Minderleister“. Das, was er nicht abarbeitet, müssen die anderen in der Abteilung auffangen. Das kann ich ihnen nicht zumuten. Also habe ich ihn darauf angesprochen. Und? Keine Einsicht. Völlig abgeblockt. Er sieht das Problem bei mir. Der hasst mich jetzt.
Jemand, der auf meiner Seite ist
Andere Führungskräfte würden vielleicht sagen: „Das ist meine Rolle. Ich muss es ertragen, nicht geliebt zu werden.“ Aber ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und wünsche mir ein friedliches Miteinander. Meine Mitarbeitenden sollen mich vielleicht nicht lieben, aber sympathisch finden. Sie sollen mich mögen. Denn ich mag sie ja auch. Es interessiert mich, wie es ihnen geht. Ich weiß, dass hinter jedem ein Schicksal steht und ich für meine Schäfchen Verantwortung trage.
Mein oberstes Ziel ist, dass es allen gutgeht und sie gern zur Arbeit kommen. Ich möchte auf keinen Fall, dass sie sich schlecht fühlen oder Angst haben. Und das gelingt mir nicht. Wenn ich sie kritisiere, geht es ihnen nicht gut. Und natürlich kommen sie nicht gern zur Arbeit, wenn sie ein unangenehmes Gespräch mit ihrer Vorgesetzten hatten. Ich möchte nicht „die böse Chefin“ sein – und bin es doch.
Ich wäre gern weniger emotional. Eine schlechte Note während meiner Ausbildung hat mich nie getroffen. Ich habe mir die Begründung durchgelesen und damit war es für mich erledigt. Aber wenn ich heute merke, dass mich eine Mitarbeiterin schneidet oder ein anderer mich „herrisch“ nennt, kann ich das nicht abhaken. Es hilft mir nicht zu sagen: Das richtet sich gegen meine Position als Vorgesetzte. Es verfolgt mich bis ins Privatleben. Abends sitze ich auf dem Sofa und denke darüber nach. Das ist verschenkte Zeit, das weiß ich. Abstellen kann ich es trotzdem nicht. Auf Arbeit versuche ich, die Beziehung zu dieser Person wiederherzustellen: Smalltalk führen, zum Mittagessen gehen, weiter sachlich bleiben, selbst wenn ich das Verhalten blöd finde.
Mir fehlt jemand am Arbeitsplatz, mit dem ich mich austauschen kann. Zum Beispiel fragen: Wie schätzt du diese Person ein? Warum verhält die sich so? Jemand, der auf meiner Seite steht und mich unterstützt. Früher hatte ich einen Mentor, dem ich bedingungslos vertrauen und mit dem ich über alles reden konnte. Seit er vor einigen Jahren gestorben ist, bleibe ich mit meinen Grübeleien allein. Als Führungskraft bist du immer einsam.
Wollen Sie mehr zum Thema erfahren? Dann lesen Sie auch aus derselben Ausgabe: Psychotherapeutin Beate West-Leuer im Interview Gemocht werden im Beruf.