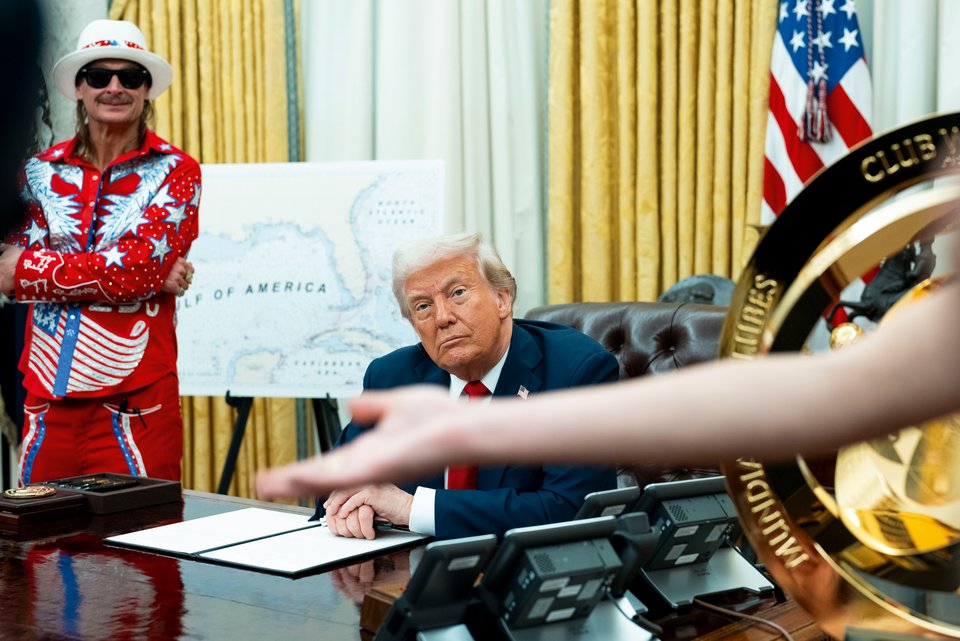Frau Dr. Mehta, bekommen Sie seit ein paar Wochen mehr Anfragen für einen Therapieplatz als sonst?
Normalerweise läuft das ziemlich saisonal ab. Ich erhalte zum Beispiel viele Anrufe von Studierenden, die meisten im August zu Semesterbeginn. Davon abgesehen sind die Zahlen zuletzt tatsächlich leicht nach oben gegangen. Ich bin mir aber sicher, es wären noch deutlich mehr Anfragen, wenn nicht so viele Menschen gerade ihre Krankenversicherung verloren oder Angst vor so einem Verlust hätten. Wir Therapeutinnen…
Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen
gerade ihre Krankenversicherung verloren oder Angst vor so einem Verlust hätten. Wir Therapeutinnen und Therapeuten erarbeiten gerade kostengünstige Alternativen für diese Menschen, denn der Bedarf ist da.
Können Sie diesen Zusammenhang erklären?
Hier in Washington arbeiten sehr viele Menschen für Ministerien und die Bundesbehörden. Die Trump-Regierung entlässt im großen Stil Mitarbeitende des Bundes. Die Unsicherheit in Washington ist riesig. Es wirkt, als habe jeder eine Freundin, einen Freund oder Familienangehörige, die gerade gefeuert wurden oder ihren Job verloren haben, weil Fördergelder gestrichen wurden. In den USA ist die Krankenversicherung an den Arbeitgeber gebunden, und es kostet viel Geld, medizinische Behandlungen aus eigener Tasche zu bezahlen. Die finanzielle Unsicherheit hält viele davon ab, um psychologische Hilfe zu bitten.
Hat sich in Ihrer Arbeit seit der Präsidentschaftswahl im vergangenen November etwas verändert?
Nach der Wahl haben die meisten noch gedacht, dass es wieder läuft wie beim letzten Mal: viel Anspannung, eine Menge Verschwörungstheorien, eine starke Spaltung. Aber mit der Amtseinführung im Januar kam alles ganz anders. Es war der Beginn einer entfesselten Politik, mit der die meisten so nicht gerechnet hatten.
Wie erleben Sie das in Ihrer Praxis als Psychotherapeutin?
Ich habe Patientinnen und Patienten, die in ihrer Lebensgeschichte traumatisiert worden sind. Am schwersten ist es für Menschen mit Missbrauchserfahrung. Bei vielen von ihnen kommt jetzt das alte Trauma wieder hoch. Ich sehe aber auch Menschen, die für Ministerien oder Bundesbehörden arbeiten. Dort gibt es den Verdacht, dass sie bei der Arbeit überwacht werden. Für manche fühlt es sich an wie bei Big Brother. Niemand hätte so etwas bei uns für möglich gehalten. Die Situation ist nicht mehr normal.
Wer für den Staat arbeitet, hat womöglich ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis.
Normalerweise sind das ja auch sehr stabile und sichere Jobs. Im Kern sehe ich bei den Betroffenen tatsächlich das Gefühl, verraten und verlassen worden zu sein. Psychologisch gesprochen können unsere Vorgesetzten und unsere Regierung die Rolle von Autoritätsfiguren spielen, in denen auch eine elterliche Komponente steckt. Jetzt setzen einen diese Elternfiguren vor die Tür. Die Situation rührt an einen wunden Punkt bei Menschen, die in instabilen Familien aufgewachsen sind. Wer dagegen in einer einigermaßen stabilen Familie groß geworden ist – nun, für den ist das eine neue Erfahrung. Die Menschen stellen sich die Frage: Wie kann mich jemand so im Stich lassen?
Es gibt Studien, die untersucht haben, wie sich die Psychotherapie in den USA während Donald Trumps erster Amtszeit verändert hat. Ein Ergebnis war: Es wurde während der Sitzungen viel mehr über Politik gesprochen. Wie waren ihre Erfahrungen in den vergangenen Wochen?
Das stimmt, viele meiner Patientinnen und Patienten reden über Politik. Manche können über gar nichts anderes mehr sprechen, was verständlich ist. Viele haben Kolleginnen oder sogar ihr ganzes Team verloren. Andere befürchten, dass die Regierung sich bei all dem nicht an Recht und Gesetz hält. Aber vielleicht ist das auch ein Sonderfall hier in Washington. Die Stadt ist durchtränkt von Politik. Natürlich! Es ist die Hauptstadt unseres Landes. Was man vielleicht erwähnen muss: Die Bevölkerung von Washington und das Umland im Norden von Virginia und im Süden von Maryland sind sehr demokratisch. Es handelt sich um eine äußerst gebildete und engagierte Bevölkerung.
Kamala Harris hat in Washington mehr als 90 Prozent der Stimmen bekommen.
Wenn man also die Straße entlanggeht, werden die meisten Leute, die man sieht, nicht mit der aktuellen Regierung übereinstimmen. Deshalb meine Antwort: Ja, das Thema Politik begegnet mir gerade überall. Meine Patientinnen und Patienten sind sehr besorgt. Wer unter das DEI-Programm fällt, also unter eine der Kategorien „Diversität“, „Gleichberechtigung“ und „Inklusion“, hat derzeit das Gefühl: Da versucht jemand, mich auszulöschen. Wer auf der Seite dieser Menschen steht, macht sich ebenfalls Sorgen.
Wie reagieren Sie als Therapeutin darauf?
Wenn ich sehe, dass jemand mit Sorgen zu mir kommt, stelle ich normalerweise immer dieselbe Frage: „Ist Ihre Reaktion der Situation angemessen?“ Und normalerweise sagen dann viele: „Na ja, vermutlich mache ich da aus einer Mücke einen Elefanten.“ Und dann schauen wir uns das genauer an. Aber im Moment sehe ich dafür leider keine Evidenz. Die Sorgen scheinen mir nicht übertrieben zu sein. Die Regierung hat ja wirklich große Mengen von DEI-Websites vom Netz genommen. Das ist eine Tatsache.
Was brauchen die Menschen von Ihnen?
Sie brauchen Wertschätzung. Sie brauchen Unterstützung. Sie müssen, wo es möglich ist, wieder die Kontrolle übernehmen. Sie brauchen Gemeinschaft. Und dann ist da noch etwas: Es gibt eine Menge angestauter Energie, das starke Bedürfnis, etwas zu tun und ein Ventil für den eigenen Unmut zu finden. Es hat anfangs nur wenige organisierte Proteste gegen die derzeitige Regierung gegeben. Es ging los mit Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez und ihrer Tour gegen die Oligarchie. Aber ich glaube, dass wir mehr solcher Bewegungen brauchen. Es bedarf einer Opposition. Denn die Menschen brauchen das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Daran fehlt es gerade. Und das belastet meine Klientinnen und Klienten sehr. Sie wollen etwas tun, wissen aber nicht genau, was das sein könnte.
Darüber hat man sich in Deutschland doch sehr gewundert. Bei Trumps erster Amtseinführung sind hunderttausende gegen ihn auf die Straße gegangen. Davon war diesmal wenig zu sehen.
Hier wundern sich auch viele darüber, dass diese Proteste zunächst ausgeblieben sind. Ich habe neulich ein Video mit der Historikerin Heather Cox Richardson gesehen. Sie sagt: Nur etwas mehr als 4,4 Prozent der Menschen in den USA halten das Project 2025 für eine gute Idee…
…also den Plan der Trump-Administration für eine weitreichende Umgestaltung der Exekutive…
…trotzdem lagen die Zustimmungswerte für Donald Trump als Präsident lange Zeit bei 47 Prozent.
Wie erklären Sie sich das?
Ich zitiere wieder Heather Cox Richardson, mit der ich da einer Meinung bin: Wir leben in einer geteilten Gesellschaft und in unterschiedlichen Informationsblasen. Psychologisch gesprochen befinden wir uns in einer missbräuchlichen Beziehung zu unserer Regierung, in einer missbräuchlichen Beziehung zu unserem Präsidenten. Denn was tut jemand, der andere missbraucht? Er versucht zu kontrollieren, was das Missbrauchsopfer weiß und wie es die Welt sieht, wie es die ihm zur Verfügung stehenden Informationen interpretiert. Umgekehrt unterstützen manche Missbrauchsopfer den Täter, es handelt sich um eine Art Überlebensstrategie. Das spielt, wie ich glaube, eine große Rolle, wenn man erklären will, woher die hohe Loyalität vieler Trump-Anhängerinnen und -Anhänger kommt.
Hat jemand aus dem Kreis Ihrer Patienten für Trump gestimmt?
Das glaube ich nicht. Ich bin eine woman of color, meine Eltern stammen aus Indien vor dessen Teilung. Ich habe in den Medien genügend Dinge gesagt, aus denen man herauslesen kann, dass ich keine Trump-Anhängerin bin. Ich bezweifle, dass jemand, der MAGA unterstützt, mich zur Therapeutin haben möchte.
Könnten Sie mit jemandem therapeutisch arbeiten, der politisch nicht mit Ihnen übereinstimmt?
Ich denke schon. Wissen Sie: Es herrschen viel Unsicherheit und Schmerz in unserer Bevölkerung. Viele haben deshalb jemanden gewählt, der sich hinstellt und sagt: „Ich bin der Einzige, der die Sache in Ordnung bringen kann.“ Die Leute haben alles auf diese Karte gesetzt. Nach dem Motto: Okay, dann probieren wir’s mal mit dem. Außerdem leben in unserem Land viele Menschen, die aus allen möglichen Gründen traumatisiert sind oder leiden. Deshalb würde ich die Person vor mir fragen: Wer bist du? Was hast du erlebt? Was hat dich hierhergebracht? Und dann würde ich sehr genau hinhören, welche Spuren von Trauma, Unsicherheit und Zukunftsangst dabei auftauchen. Die Forschung zeigt, dass diejenigen Menschen, die politisch nach rechts tendieren, mehr Angst vor der Zukunft haben. Ich denke, das ist etwas, auf das man achten sollte.
Etliche Ihrer Kolleginnen reden zwar mit den Medien über unser heutiges Thema, wollen aber lieber anonym bleiben. Sie waren zu diesem Interview bereit. Wie sicher fühlen Sie sich dabei?
Ich fühle mich nicht mehr so sicher wie noch vor einigen Monaten. Andererseits: Was wäre denn die Alternative? Ich habe mein Leben der Aufgabe gewidmet, Menschen zu helfen, und was im Moment geschieht, schadet vielen. Wenn ich dazu schweige – wem würde das nützen? Ich gehe davon aus, dass ich noch immer in einem Land lebe, in dem man seine Meinung sagen und eine gesunde Debatte führen kann.
Wie belastend ist diese Zeit für Sie persönlich?
Was das angeht, rede ich sehr offen mit meinen Klienten. Ich sage, dass Psychotherapeutinnen und -therapeuten nicht ausgebildet sind für existenzielle Situationen wie den Zusammenbruch der Demokratie. Ich wurde ausgebildet für Angststörungen, Depressionen, Anpassungsstörungen und so weiter. Aber seit einigen Jahren hält etwas anderes Einzug in meine Praxis. Ich bekomme Anrufe von Menschen, die Angst haben wegen des Klimawandels, also vor existenzielleren Dingen. Sie können nicht aufhören, daran zu denken. Wir haben es mit einem kollektiven Problem zu tun, auf das es auch nur eine kollektive Antwort geben kann. Genau das sehe ich heute wieder. Ich denke, dass Psychotherapie helfen kann, aber es bedarf einer kollektiven Antwort.
Und wie helfen Sie den Menschen dann?
Ich habe den Eindruck, dass die Therapeutengemeinschaft dabei auf verschiedene Behandlungsmodelle zurückgreift. Ich denke, es geht darum, die Situation möglichst zutreffend einzuschätzen. Deshalb stelle ich auch hier die Frage: Ist Ihre Reaktion der Situation angemessen oder ist sie unverhältnismäßig? Das scheint für die Klienten sehr klärend zu sein. Eine befreundete Therapeutin hat neulich etwas Kluges gesagt: Self-care is an act of resistance. Ich liebe diesen Satz! Er beschreibt genau das, was wir als Therapeutinnen und Therapeuten intuitiv tun in diesen Tagen. Dieser Satz hat vieles an unserer Haltung auf den Punkt gebracht.
Also: Selbstfürsorge ist ein Akt des Widerstands.
Für Kinder war es während der Ereignisse vom 11. September sehr beängstigend, zu sehen, wie ihre Eltern und überhaupt die Erwachsenen die Kontrolle verloren haben. Das war dann die Aufgabe von Psychotherapie: Eltern dabei zu helfen, jene Dinge wieder in die Hand zu nehmen, die in ihrer Kontrolle lagen, damit die Kinder wieder ein Gefühl von Geborgenheit bekommen konnten. Ich glaube, wir sind heute wieder bei diesem Ansatz angelangt: Was hat man unter Kontrolle?
Mit welchen Augen schauen Sie gerade auf Ihr Land?
Meine Eltern sind als Einwanderer hierhergekommen, mein Vater war nach seinem Weggang sogar eine Weile ein Geflüchteter. Bei ihm zu Hause gab es kein Licht. Also ist er immer abends zum Bahnhof gegangen, um zu lesen und zu lernen. Dass ich hier promovieren konnte und jetzt meine eigene Chefin bin, ist eine ziemlich unglaubliche Story. Ich habe es immer als großes Glück empfunden, US-Amerikanerin zu sein und einen US-Pass zu besitzen. Es war nicht alles perfekt, aber ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Vielfalt geschätzt wurde und größtenteils willkommen war. Ich habe jetzt eine Weile daran gezweifelt, ob das noch immer der Fall ist. Aber die Ereignisse der letzten Woche haben meinen Glauben daran gestärkt, dass viele Menschen in diesem Land immer noch diese Werte vertreten.
Was macht Sie so optimistisch?
Mir ist die historische Rede des demokratischen Senators Cory Booker Anfang April wie ein Wendepunkt vorgekommen; republikanische Senatoren haben sich gegen Trumps Zollpolitik gestellt; es gab den weltweiten Hands-Off-Protestmarsch. – Die angestaute Energie hat endlich ein Ventil gefunden, es gibt Anzeichen dafür, dass man gehört wird und nicht allein ist und dass die Proteste weitergehen.
Eine letzte Frage aus privatem Interesse: Sie haben für einige Zeit in Hamburg gewohnt. Wie haben Sie die Stadt erlebt?
Ich kann nicht sagen, dass ich in Hamburg schlecht behandelt worden bin. Die Leute waren freundlich. Aber es war auch stark abhängig vom Kontext. In Wandsbek…
…einem klassischen Arbeiterviertel…
…war ich für die meisten nur eine weitere Ausländerin aus dem Mittleren Osten. Am Jungfernstieg dagegen war ich eher die interessante US-Amerikanerin. Insgesamt aber hätte ich in Hamburg niemals dieselben Karrierechancen gehabt wie hier in den USA, was natürlich auch an der Sprache lag. Letzten Endes glaube ich, dass es für mich als Frau und Person of Color keinen besseren Ort gibt als eine der beiden Küsten der USA. Hier gehöre ich hin.
Vinita Mehta ist Psychotherapeutin und Autorin. Nach ihrem Studium an der Harvard University promovierte sie an der Columbia University. Sie gehört zu den Macherinnen der TV-Dokumentation This Emotional Life.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an:redaktion@psychologie-heute.de).
Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.